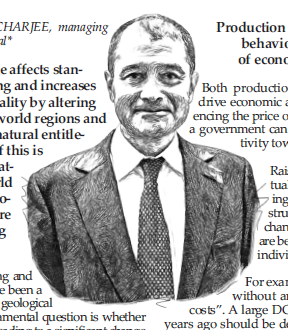Von Shanu Sherwani, CIO Kneip Management / Partner Antwort Capital
Private Equity sitzt auf einer Liquiditäts-Zeitbombe. Ausschüttungen sind auf historische Tiefststände gefallen, Investoren werden unruhig und das Fundraising verliert an Schwung. Anders als in früheren Krisen wurde dieser Engpass nicht durch eine Rezession oder einen Finanzkollaps ausgelöst – er ist das Ergebnis eines Marktes, der zwischen hohen Bewertungen, blockierten Exits und einer kollektiven Zurückhaltung beim Verkaufen feststeckt.
Dennoch ist dieser Moment nicht nur eine Bedrohung; er ist ein Test. Die Häuser, die gestärkt hervorgehen, konzentrieren sich auf das Wesentliche – operative Wertschöpfung, diszipliniertes Liquiditätsmanagement und Transparenz gegenüber Investoren.
Ein historischer Einbruch der Ausschüttungen
Die Ausschüttungen an Limited Partners (LPs) sanken 2024 laut Bain & Company auf nur 11 % des Nettoinventarwerts (NAV) – deutlich unter den 20–30 %, die in einem gesunden Zyklus üblich sind. Effektiv verlängert sich damit der Wiederanlager-/Recycling-Horizont von vier auf zehn Jahre. So niedrige Ausschüttungen gab es zuletzt 2008–09 auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise.
• 2022: 15 % Ausschüttung zu NAV
• 2023: 12 %
• 2024: 11 %
Sollte 2025 dieser Trend anhalten, würde die Branche vier aufeinanderfolgende Jahre historischer Illiquidität verzeichnen – beispiellos in der modernen Private-Equity-Geschichte.
Das Backlog-Problem
Buyout-Portfolios halten derzeit rund 30.000 Unternehmen im Wert von 3,6 Billionen US-$; die Hälfte davon liegt seit mehr als fünf Jahren im Bestand. Zum Vergleich: Alle weltweit abgeschlossenen Buyouts summierten sich 2024 auf nur etwa 600 Mrd. US-$. Den heutigen Rückstau abzubauen, würde Jahre robuster Exit-Aktivität erfordern – selbst wenn keine neuen Deals hinzukämen.
Viele GPs zögern, unter Zielbewertung zu verkaufen, und warten auf bessere Märkte. Nach der GFC hat sich diese Geduld ausgezahlt, als die Multiples zurückkamen – doch das heutige Hochzinsumfeld macht eine ähnliche Erholung weniger wahrscheinlich. Um Liquidität wiederherzustellen, müssen starke Manager disziplinierte Exits vorantreiben – auch wenn sich die Preise „unangenehm“ anfühlen.
Fundraising unter Druck
Die Folgen sind bereits sichtbar. Buyout-Fundraising fiel 2024 um 25 %, und im frühen Jahr 2025 schloss im ersten Quartal kein Fonds über 5 Mrd. US-$ – eine Seltenheit in jüngerer Zeit. Ohne Ausschüttungen zögern LPs mit Re-Ups. Ohne Re-Ups verschieben GPs Exits weiter.
Kapital ziehen derzeit jene Häuser an, die klar kommunizieren, realistische Erwartungen setzen und greifbare operative Fortschritte in ihren Portfolios zeigen. Liquidität mag knapp sein – doch Transparenz schafft Vertrauen, und Vertrauen bringt Commitments.
Blockierte Exit-Kanäle
Klassische Exit-Wege bleiben eingeschränkt:
• IPO-Fenster sind weitgehend geschlossen.
• Strategische Käufer agieren vorsichtig.
• Sponsor-to-Sponsor-Deals sind aktiv, leiden aber unter Bewertungslücken.
Um Liquidität zu schaffen, greifen GPs zunehmend zu Fortführungsfonds (Continuation Vehicles), Teilverkäufen und Sekundärtransaktionen. Diese Instrumente können valide sein – jedoch nur mit sauberer Governance, Interessengleichlauf und echtem Fokus auf die Investorenergebnisse.
Secondaries: Abschlag oder Chance?
Sekundärmärkte sind gut positioniert, von der Liquiditätsknappheit zu profitieren. LPs verkaufen Fondsanteile mit Abschlägen, während GPs Fortführungsvehikel aufsetzen. Die Schlüsselfrage lautet jedoch, ob die aktuellen NAVs die Realität widerspiegeln. Ein 20 %-Abschlag auf einen überhöhten NAV ist kein Schnäppchen – sondern eine Illusion.
Für LPs war Managerselektion nie wichtiger. Die besten Secondary-Manager sind nicht bloß Schnäppchenjäger; sie investieren diszipliniert, können echten Wert von Schaum trennen, unterstützen Portfoliounternehmen aktiv und setzen Liquiditätsinstrumente verantwortungsvoll ein.
Fortführungsfonds: Werkzeug oder Zündstoff?
Fortführungsfonds wurden entwickelt, um die Haltedauer starker Assets zu verlängern. Im Idealfall erlauben sie GPs, ein bewährtes Unternehmen von einem Fonds in einen anderen zu verkaufen – mit einem Liquiditätsereignis für bestehende LPs und frischem Upside für jene, die bleiben oder reinvestieren.
Werden sie „at arm’s length“ strukturiert – mit echter Preisfindung und klarer Governance – können Continuation Vehicles Investoren gut dienen. Werden sie hingegen genutzt, um schwer verkäufliche Unternehmen zu „parken“ oder Realität hinauszuzögern, drohen sie zum Symbol finanzieller Ingenieurskunst zu werden. Gute GPs kennen den Unterschied und nutzen das Instrument wofür es gedacht ist: Wert freizusetzen, nicht Illiquidität zu kaschieren.
Der Aufstieg von Family Offices und Privatanlegern
Family Offices und private Investoren werden zur neuen Frontier im Private-Equity-Fundraising. UBS berichtet, dass Family Offices inzwischen nahezu 20 % ihrer Portfolios in Private Equity allokieren, während Preqin schätzt, dass Privatvermögen bis 2030 rund 30 % des Fundraisings in Alternativen ausmachen könnte.
Viele dieser Investoren stammen aus unternehmerischem Vermögen und bringen eine „Business-Builder-Mentalität“ mit. Sie professionalisieren sich zunehmend – stellen interne Investment-Teams ein, verlangen Reporting auf institutionellem Niveau und suchen mehr Einfluss durch Secondaries, Co-Investments und Direktbeteiligungen.
Für GPs ist dieser Trend Chance und Herausforderung zugleich. Family Offices sind flexibel, aber selektiv. Sie schätzen Alignment, Transparenz und Klarheit über Liquiditätszeitleisten. Jene GPs, die zu den Grundlagen zurückkehren – operative Wertschöpfung, diszipliniertes Capital Recycling und klare Kommunikation – werden ihr Vertrauen gewinnen.
Benchmarking gegen liquidere Alternativen
Die Liquiditätsklemme veranlasst LPs, PE-Renditen stärker mit Aktien, Hedgefonds und Private Credit zu vergleichen – alles Anlageklassen mit schnellerer Kapitalwiederanlage. Liquidität zieht Aufmerksamkeit auf sich, doch der Vorteil von Private Equity war nie Geschwindigkeit; er liegt in Kontrolle, Einfluss und der Fähigkeit, Unternehmen über die Zeit zu transformieren.
Die besten GPs nehmen diesen Unterschied an, statt sich vor ihm zu verstecken – sie fokussieren wieder auf hands-on operative Verbesserungen, klügeres Kostenmanagement und Wertschöpfung, die nicht von Multiple-Expansion abhängt. Diese Manager können Illiquidität rechtfertigen, indem sie echte Alpha-Generierung liefern.
Der Weg nach vorn
Private Equity hat Krisen schon oft überstanden – und die Branche hat sich jedes Mal weiterentwickelt. Die heutige Liquiditätsklemme ist keine Ausnahme. Überleben und Erfolg werden jene Fonds haben, die sich ihr frontal stellen, Marktrealitäten akzeptieren und echte Liquiditätsstrategien aufbauen – statt schnelle, finanztechnische Scheinlösungen zu suchen.
Die „Liquiditäts-Zeitbombe“ wird Private Equity nicht zerstören – aber sie wird den Unterschied offenlegen zwischen Managern, die verzögern, und solchen, die liefern. Am Ende könnte diese Phase als Reset dienen – sie belohnt GPs, die zu den Fundamentals zurückkehren, und bestätigt, warum die besten Investoren langfristig in dieser Assetklasse bleiben.